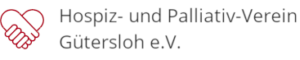„Die schwersten Wege werden allein gegangen.“ Dieser Satz, mit dem ein Gedicht von Hilde Domin beginnt, hat eine besondere Aktualität. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ist es manchmal nicht möglich, kranke und sterbende Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten. Während im Hospiz weiterhin Angehörige beim Sterbenden sein dürfen, ist das in anderen Situationen und Einrichtungen leider oft anders. Wie geht man damit um, wenn man sich nicht verabschieden kann?
In den Beratungsgesprächen im Hospiz- und Palliativ-Verein Gütersloh erlebt Trauerbegleiterin Elisabeth Schultheis-Kaiser derzeit oft Menschen, die diese Frage umtreibt. So wie die Frau, deren Mann im letzten Jahr zu einer Routine-Operation ins Krankenhaus ging. Auf einmal der Anruf: es gab ernste Komplikationen. Ein Besuch sei nicht möglich, aber sie dürfe anrufen. Immer wieder muss die Ehefrau bei ihren Anrufen ihr Anliegen neu vortragen, oft weiß gerade niemand aktuell Bescheid über den Zustand ihres Mannes, es gibt wenig Rückmeldungen. „Damit beginnt dann das Kopfkino“, beschreibt die Trauerbegleiterin diese für ihre Klientin zermürbende Zeit. Als die Frau endlich ins Krankenhaus kommen darf, liegt ihr Mann bereits im Sterben. „Alles, was zwischen dem Routineeingriff und dem Sterben liegt, fehlt für diese Angehörige. Das macht es sehr schwer“, so Schultheis-Kaiser.
Der Tod bleibt unvorstellbar
In einer ähnlichen Situation habe es einem ihrer Klienten zumindest geholfen, dass sich auf der Intensivstation die Pastorin mit ans Bett gesetzt hat, sie sei dabeigeblieben, habe zugehört und mit in die Trauer geholfen. Ähnlich wie bei plötzlichen, unerwarteten Todesfällen wie einem Autounfall oder einem Herzinfarkt fehlen auch beim Tod unter Corona-Bedingungen oft die Zwischenschritte. Das kann das Begreifen und die Trauer erschweren. Der Tod bleibt lange Zeit unvorstellbar. Oft quälen unbeantwortete Fragen nach dem ‚Warum‘ und ob man etwas hätte anders machen können.
„Ich verspreche dir, ich schaffe das“
Manche sehen ihren Angehörigen nicht einmal mehr im letzten Moment, ihnen bleibt nur die Nachricht vom Tod. Elisabeth Schultheis-Kaiser erinnert sich an Trauergespräche mit einem Mann, dessen Frau an den Folgen von Covid gestorben ist. Er hatte sie im Krankenhaus nicht mehr besuchen können. Lediglich telefonieren war möglich, als eine Schwester seiner Frau den Hörer ans Ohr hielt. ‚Du darfst gehen. Ich verspreche dir, ich schaffe das‘, habe er ihr gesagt, bevor sie starb. Dieses Versprechen trage ihn momentan in der Trauer, erzählt der Mann im Einzelgespräch bei der Trauerbegleitung. Er habe es als Verpflichtung genommen: An jedem Tag erledigt er nun zwei Dinge, die er sich vorgenommen hat. Jedes Angebot von Freunden zum Spazierengehen nimmt er an. Er steht immer um die gleiche Zeit auf. „Hier hat jemand instinktiv für sich gespürt, was es braucht, um durch den Tag zu kommen“, so Schultheis-Kaiser. „In der Beratung versuchen wir gemeinsam mit den Trauernden etwas zu finden, das ihnen Halt gibt.“
Viele Trauernde beschäftigt besonders, dass sie im Sterbemoment nicht da sein konnten. Die Trauerbegleiterin versucht dann, den Blick zu weiten und behutsam eine andere Perspektive zu öffnen: „Auch die vielen gemeinsamen Jahre vorher sind doch wichtig, auch und gerade im Verhältnis zu diesem einen Moment.“
Ein letztes Foto
Nichtsdestotrotz fehlt vielleicht genau dieser Moment, um zu begreifen. Das erlebten auch Mitarbeitende eines Krankenhauses. Menschen, deren Angehörige hier verstorben sind, hatten zum Teil weder die Möglichkeit, im Sterbeprozess dabei zu sein noch danach den oder die Verstorbene(n) zu sehen. „Meine Mutter ist bei Ihnen verstorben, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen“ – Anrufe wie diese zeigten die Verzweiflung der Menschen. Die Mitarbeitenden im Krankenhaus suchten deshalb nach einer Möglichkeit, den Tod greifbarer, fassbarer zu machen. Und so wird nun von Verstorbenen ein Foto gemacht. Die Pflegekräfte fragen dann die Angehörigen, ob sie das Bild sehen möchten. Vielen hilft das, um überhaupt mit ihrer Trauerarbeit beginnen zu können.
Einen Angehörigen durch Corona zu verlieren, oder nicht da sein zu können, wenn jemand aufgrund einer anderen Erkrankung den letzten Weg aufgrund der Pandemiebeschränkungen allein gehen muss: Elisabeth Schultheis-Kaiser ist wichtig, dass Menschen sich in dieser Situation mit ihrem Leid gesehen fühlen. Sie und ihre Kollegin bieten in der Trauerbegleitung dabei Unterstützung an: „Es gibt Wege, statt der fehlenden physischen Nähe in Abschied und Trauer eine emotionale Nähe zu schaffen. Wenn unter den aktuellen Umständen viele Rituale nicht mehr greifen, müssen wir neue suchen.“
Das Gedicht von Hilde Domin, das mit den Worten „Die schwersten Wege werden alleine gegangen“ beginnt, endet übrigens auch mit einem tröstenden Ritual:
„Nimm eine Kerze in die Hand
Wie in den Katakomben
Das kleine Licht atmet kaum
Und doch, wenn du lange gegangen bist,
bleibt das Wunder nicht aus,
weil das Wunder immer geschieht.“