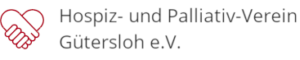Wie alles begann und wie es weitergeht ….
Der Hospiz- und Palliativ-Verein Gütersloh ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Ein guter Anlass, die Geschichte Revue passieren zu lassen und in die Zukunft zu schauen: Zum Tischgespräch trafen sich dazu der Mitgründer des Vereins Professor Dr. med. Claus Gropp und die langjährige ehemalige Mitarbeiterin Elisabeth Schultheis-Kaiser und ihre Nachfolgerin als Koordinatorin, Evelyn Dahlke.
Evelyn Dahlke: „Ich bin erst seit einigen Monaten in dem Verein tätig, den Sie vor drei Jahrzehnten mitgegründet haben, Herr Professor Gropp. Erzählen Sie doch mal, wie sich das damals entwickelt hat.“
Prof. Claus Gropp: „Ich kam 1986 nach Gütersloh ans Klinikum mit dem Auftrag, eine onkologische Station aufzubauen. Damals gab es nur wenige onkologische Zentren. Schon nach zwei Jahren hatten wir rasant steigende Patientenzahlen. Das führte natürlich dazu, dass auf der Station auch viele Schwerkranke lagen und auch solche, die nicht mehr geheilt werden konnten. Diese schwerkranken Menschen waren unsere große Sorge. Früher wurden Menschen, die nicht mehr behandelt werden konnten, einfach nach Hause entlassen. Sicher, damals war gerade im ländlichen Gebiet auch mehr noch die Möglichkeit, im Familienkreis zu sterben, das ist ja eigentlich auch gut so. Nun waren sie bei uns auf der Station, aber stellen Sie sich mal vor, es gab quasi noch keine wirkliche Schmerztherapie! Die schwerkranken Patienten machten uns deswegen Kummer, weil wir sie am Anfang nicht wirklich gut versorgen konnten. Wir hatten keine Erfahrung, wir wussten nicht, wie man letztendlich damit umgeht.
„Wir haben nach Wegen gesucht, wie das anders geht“
So war das. Aber das ging so nicht, das wollten wir nicht. Das war, was uns dann umgetrieben hat, das zu ändern. Schon allein die Räumlichkeiten waren nicht da, um Menschen mit starken Schmerzen adäquat zu versorgen, die Zimmer waren oft mit sechs bis acht Betten belegt. Auch auf die Angehörigen der schwerkranken Patienten konnten wir unter den damaligen Umständen nicht genug eingehen. Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, insbesondere ja auch Sie, Frau Schultheis-Kaiser und ihr Mann, Dr. Herbert Kaiser. Und so haben wir nach Wegen gesucht, wie das anders geht. Man kommt natürlich immer wieder auf die Gründerin des ersten Hospizes in London zurück, Cicely Saunders, das war die Grundidee, ebenso der Blick in die nordischen Länder, wo die Hospizidee schon eher angekommen war. Die Idee war, dass die Menschen in Würde sterben dürfen und durch eine echte Schmerztherapie Patienten nicht leiden müssen. Das hat uns inspiriert, und wir haben gedacht ‚Mensch, das müssten wir auch machen‘. Es gab dann ja auch in Köln und Aachen erste Hospize. Dort haben wir dann Kontakt aufgenommen, und Familie Kaiser hat ja auch dafür gesorgt, dass wir dann viele Vorträge hatten, von Menschen, die schon Erfahrung mit der Hospizidee hatten.“
Elisabeth Schultheis-Kaiser: „Ja, zum Beispiel Pater Zielinsky. Wir haben mit ihm unseren ersten Vortrag gemacht, und da kamen 200 Leute! Da merkte man, wie groß der Bedarf war. Professor Gropp, ich überlege dabei gerade so: Sie waren immer von diesem Gedanken überzeugt, und es ist Ihnen ja auch gelungen, andere Menschen damit zu begeistern. Aber es bedurfte sicherlich auch viel Werbung für die Sache bei Ihren ärztlichen Kollegen, oder?“
C.G.: „Allerdings. Selbst in der eigenen Klinik hatten wir erhebliche Schwierigkeiten. Es gab Kollegen, die meinten, sowas braucht man nicht. Besonders als es dann um die Palliativstation ging, die wir aufgebaut haben. Die haben viele als Fremdkörper empfunden. Damals waren die Zimmer im Krankenhaus unwohnlich karg. Und dann kamen wir mit unserer Idee. Und wir dachten: ‚Wie kommen wir damit jetzt bloß weiter?‘. Zum einen haben uns dann die vielen Vorträge geholfen, die Sie, Frau Schultheis-Kaiser organisiert haben. Und Sie haben sich ja auch intensiv um die Verbindungen und die Verbreitung ins Kreisgebiet gekümmert. Zum anderen war es ja eine Frage der Finanzierung.“
E.S.-K.: „Das macht die Startschwierigkeiten sehr deutlich. Geholfen hat da sicherlich ungemein, dass es Ihnen dann gemeinsam mit dem damaligen Verwaltungsleiter des Krankenhauses, Herrn Hanschmann, gelungen ist, die Palliativstation in den Bettenbedarfsplan des Landes Nordrhein-Westfalens aufnehmen zu lassen.“
„Wir haben die Palliativstation wirklich aus Eigenmitteln finanziert“
C.G.: „Ja, das war natürlich ein großer Schritt. Damals war es so, dass, wenn ein Fachgebiet nicht im Bedarfsplan eines Krankenhauses war, wurde auch vom Land kein Geld dafür bezahlt. Herr Hanschmann hat sich sehr verdient darum gemacht, dass die Betten der Palliativstation in den Bedarfsplan kamen. Das Wichtige für uns war einfach, dass wir geeignete Räume für schwerkranke Patienten hatten, und dass wir auch genug Menschen hatten, die sie sich um die Leute kümmern. Auf einer normalen Station mögen die Pflegenden noch so gut sein, und das waren sie bestimmt auch, sie haben sich wirklich rührend um die Patienten gekümmert, aber es ging einfach aus Zeitgründen nicht, und auch aus räumlichen Gründen nicht. Und deswegen war es so wichtig, dass wir versucht haben eine Station zu schaffen, wo spezielle, ruhigere Räume waren, und eben auch genug Personal. Worauf ich natürlich besonders stolz bin, ist, dass wir die Palliativstation wirklich aus Eigenmitteln finanziert haben. Wir haben dazu 1991 den ‚Verein zur Förderung des Hospizes am Städtischen Krankenhaus Gütersloh‘ gegründet, der heutige ‚Hospiz- und Palliativ-Verein Gütersloh‘. Nach fünf Jahren konnte dann im Dezember 1996 die Palliativstation ihre Arbeit aufnehmen. Viele wissen gar nicht, dass wir rund zehn Jahre noch Personal bezahlt haben. Das waren alles Spenden. Und je mehr das bekannt wurde, desto mehr wurde gespendet. Auch von Angehörigen von Verstorbenen, das ist natürlich so. Aber es zeigt auch, dass die Patienten und die Angehörigen sich wohl und wertgeschätzt gefühlt haben. Wenn man dann von einer anderen Station auf die ‚Palli‘ kam, das war, als würde man in eine ganz andere Welt kommen.“
E.S.-K.: „Wie sind Sie in diesen fünf Jahren trotz aller Widerstände immer bei der Stange geblieben, bis die Palli eröffnet werden konnte?“
C.G.: „Das war das Ziel, und daran habe ich geglaubt. Deswegen haben wir uns da nicht von abbringen lassen. Ein ganz wichtiger Partner war eben Herr Hanschmann. Das ist jemand, der lässt sich durch nichts aufhalten. Er war Verwaltungsleiter. Er ist der einzige Verwaltungsleiter, den ich in meiner langen klinischen Tätigkeit kennengelernt habe, für den immer der Patient im Vordergrund stand. Ich weiß noch, wir haben oft in meinem Zimmer gesessen und überlegt, schaffen wir das überhaupt, und Hanschmann sagte, das schaffen wir.“
E.D.: „Das haben Sie sehr beeindruckend beschrieben, man kann sich jetzt gut vorstellen, wieviel Einsatz da notwendig war! Ab wann wurden denn dann auch ambulante Begleitungen durchgeführt?“
„Am Anfang war da viel Widerstand.“
E.S.-K.: „Als 1996 Professor Gropp mich fragte, ob ich mir vorstellen kann, die ambulante Hospizarbeit aufzubauen, habe ich ja gesagt. Wir haben Werbung gemacht, und dann haben sich acht Teilnehmer für einen Hospizkurs angemeldet. Den haben wir in der damaligen Diabetes-Tagesklinik gemacht. Wenn man da reinkam, lag da eine Beatmungspuppe. Das war immer ganz schrecklich für die Leute, wenn die reinkamen, da lag dann schon jemand …! (alle lachen) Dann hat Professor Gropp dafür gesorgt, dass wir im damaligen Schwesternwohnheim ein kleines Büro bekommen haben.
Am Anfang gab es so die ambulante Begleitung im heutigen Sinne noch nicht, es waren zunächst Patienten im Krankenhaus. Ich war als Psychologin ehrenamtlich auf der Palliativstation. Wenn dann die Patienten entlassen wurden, haben wir sie zu Hause weiter begleitet. Durch die Kurse kamen nach und nach Ehrenamtliche dazu. Dann haben wir geguckt, wie erreichen wir die Pflegekräfte? Wir haben im Hörsaal der Krankenpflegeschule Schulungen gemacht, die Hauptthemen waren Essen und Trinken und Schmerztherapie. Wir haben das damals Home Care Projekt genannt. Und auch die Hospizkurse zogen Kreise: Es kamen zunehmend Leute aus anderen kleinen Orten. Die haben dann nach Kursende eigene Gruppen gegründet, heute sind es 14 Gruppen im Kreis.
C.G.: „Das war schon eine beachtliche Leistung.“
E.S.-K.: „Am Anfang da gab es wirklich viel Widerstand. Ähnlich, wie Sie es eben gesagt haben, ‚Hospiz, ne, das wollen wir nicht, und wir sterben nicht‘.“
C.G.: „Die Medizin wurde damals völlig anders verstanden als heute. Es war Auffassung der Ärzte, wenn einer ins Krankenhaus kam, alles zu tun, um ihn zu heilen. Ich weiß noch, als ich zuvor in Marburg als kleiner Assistent war und ich Nachtdienst hatte. Und wenn ich dann am nächsten Morgen berichtete, einer ist gestorben, dann wurde ich hochnotpeinlich befragt, warum der nicht noch lebt. Heute ist das ganz anders. Wir können nicht alle heilen, aber wir können viele Patienten oft noch viele Jahre bei guter Lebensqualität versorgen.“
E.S.-K.: „Was muss das für ein großer Paradigmenwechsel gewesen sein, wenn die Hospizeinrichtungen dann daherkommen und sagen ’so, hallo, ihr müsst das Sterben auch zulassen‘.“
C.G.: „Das war der größte Umbruch, den ich in meinem beruflichen Leben erlebt habe. Ich wurde ja auch so ausgebildet, wenn einer stirbt, das wurde als Niederlage gesehen. Aber das änderte die Hospizbewegung in Deutschland, die ja dann auch politisch Rückendeckung bekommen hat.“
„Wir haben zum Glück viele ehrenamtliche Helfer.“
E.S-K.: „Mir ist beim Zuhören eine weitere Entwicklung aufgefallen. In Gütersloh ist ja die Hospizarbeit über die Onkologie entstanden. Das hat sich im Laufe der Jahre erweitert, natürlich haben wir jetzt auch kardiologische, geriatrische, psychiatrische und andere Patienten. Ein breites Spektrum, wir haben zum Glück viele ehrenamtliche Helfer. Viele davon sind uns seit vielen Jahren treu. Hier im Verein haben wir jetzt einen Generationenwechsel, und Evelyn, du bringst darüber auch eine neue Entwicklung, ein neues Thema mit hinein, vielleicht kannst du darüber erzählen.“
E.D.: „Ich habe lange in der Behindertenhilfe gearbeitet. Als Anfang der 90er die Wohnstätten entstanden, waren die Bewohner recht jung. Es gab nach dem Krieg nur noch recht wenig Menschen mit Behinderung, so dass danach quasi eine neue Generation herangewachsen ist, und es kaum ältere Menschen mit Behinderung gab. Jetzt kommen sie nach und nach ins Rentenalter und so passiert es immer öfter, dass Menschen mit Behinderung auch versterben, und immer öfter auch in den Wohnstätten. In den ersten Jahren sind sie alle im Krankenhaus gestorben. Sie wurden eingewiesen und kamen nicht wieder zurück. Inzwischen ist es aber so, dass sie zurückkommen, nach Hause, das ist ja deren zu Hause in der Wohnstätte, wo das vertraute Umfeld ist, und wo man die individuellen Kommunikationswege und Bedürfnisse kennt. Und dort sollen sie eben auch am Lebensende versorgt werden. Auf der anderen Seite hat man aber versäumt, die Mitarbeiter dort entsprechend mitzunehmen. Ich habe selbst erlebt, wie hilflos wir waren. Und wie anders es war, als wir einen Sterbefall hatten, wo wir von jemandem vom Palliativnetz begleitet wurden, wie gut das tut, und dass es auch gelingen kann, Menschen mit Behinderung in Wohnstätten am Ende ihres Lebens zu begleiten. Das habe ich zu meinem Thema gemacht. Wir werden auch in Zukunft hier in der Akademie und auch im Verein dieses Thema zu einem kleinen Schwerpunkt machen, wir werden ehrenamtliche Mitarbeiter fortbilden, und auch für Mitarbeiter in der Behindertenhilfe etwas anbieten. Und, was auch noch nicht so ganz verbreitet ist, wir werden Menschen mit Behinderung selbst ein Angebot machen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.“
E.S-K.: „Also, ich habe so das Gefühl, dass der Hospizgedanke, was unseren Verein betrifft, sehr lebendig fortgeführt wird, auch mit den Menschen, die sich das zum Inhalt ihrer Arbeit gemacht haben. Was wünschen Sie Ihrem Verein für die Zukunft, Professor Gropp?
C.G.: „Ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Ich komm ja nun viel rum, und von so vielen Menschen höre ich, wie hervorragend die Arbeit des Vereins ist und ich kenne viele, die auch ihre Angehörigen hier gehabt haben. Und die sind alle dankbar, dass es das gibt. Und wenn das so weiterginge, fände ich das gut. Und Sie, Frau Dahlke, was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft hier?
„Die Hospizbewegung war immer eine Bürgerbewegung. Auf diese Stärke sollte man sich berufen und sich einsetzen.“
E.D.: Ich erlebe oft in Fortbildungen, wo ich auch Hospizler aus anderen Regionen treffe, dass darüber gejammert wird, dass die Zusammenarbeit beispielsweise mit SAPV-Teams nicht so gut funktioniert. Ich bin aber der Meinung, die Hospizbewegung war immer eine Bürgerbewegung. Auf diese Stärke sollte man sich berufen, sich einsetzen und selber dafür sorgen, dass der Dienst bekannt wird. Da möchte ich genau so viel Energie reinstecken, wie du das gemacht hast, Elisabeth. Es gibt die Palliativstationen, die Palliativnetze – da wird schon mal die Frage gestellt, wozu braucht es dann noch die Hospizvereine. Aber eben diese Zeit mitzubringen, wie es die Ehrenamtlichen tun, dieses Herzblut – ohne sie kommt die psychosoziale Seite bei einer reinen Fokussierung auf die medizinisch-pflegerische Seite zu kurz. Dafür sind wir da, und das müssen wir deutlich machen. Es wird auch entsprechend angefragt und ich glaube, die Menschen, die sich in der Hospizbewegung tatsächlich engagieren, auch die ziehen Anerkennung, Wertschätzung und Zufriedenheit aus dem, was sie von den begleiteten Menschen zurückbekommen. Und dadurch bekommen wir ganz viel positive Rückmeldungen.“
Ich bin aber der Meinung, die Hospizbewegung war immer eine Bürgerbewegung. Auf diese Stärke sollte man sich berufen, sich einsetzen und selber dafür sorgen, dass der Dienst bekannt wird. Da möchte ich genau so viel Energie reinstecken, wie du das gemacht hast, Elisabeth. Es gibt die Palliativstationen, die Palliativnetze – da wird schon mal die Frage gestellt, wozu braucht es dann noch die Hospizvereine. Aber eben diese Zeit mitzubringen, wie es die Ehrenamtlichen tun, dieses Herzblut – ohne sie kommt die psychosoziale Seite bei einer reinen Fokussierung auf die medizinisch-pflegerische Seite zu kurz. Dafür sind wir da, und das müssen wir deutlich machen. Es wird auch entsprechend angefragt und ich glaube, die Menschen, die sich in der Hospizbewegung tatsächlich engagieren, auch die ziehen Anerkennung, Wertschätzung und Zufriedenheit aus dem, was sie von den begleiteten Menschen zurückbekommen. Und dadurch bekommen wir ganz viel positive Rückmeldungen.“