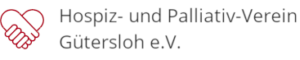Wie begleiten wir Menschen mit geistiger Behinderung im Sterben?
Sterben Menschen mit geistiger Behinderung eigentlich anders? Brauchen sie auf dem letzten Weg eine besondere Begleitung? Von Astrid L.*, einer Frau mit geistig-seelischer Behinderung, haben alle, die in den letzten Monaten ihres Lebens an ihrer Seite waren, darüber viel gelernt.
Astrid L. war 64 Jahre alt, als bei ihr Speiseröhrenkrebs festgestellt wurde. Zu dieser Zeit lebte sie in einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Das war seit vielen Jahren Frau L.s Zuhause. Hier war sie angekommen, nachdem sie zuvor als Kind der 50er-Jahre noch Psychiatrie und Heime erlebt hatte. Hier entdeckte sie auch ihre Liebe zum Malen – es fanden sogar Ausstellungen mit ihren farbstarken Bildern statt.
Ihre Krebsdiagnose führte Frau L. durch verschiedene Kliniken, in denen Untersuchungen gemacht und Therapien überlegt und wieder verworfen wurden.
Die medizinische Odyssee löste bei Frau L. Panik und Krämpfe aus. In diesem Zustand kam sie auf der Palliativstation des Klinikums Gütersloh an. Der Krebs sollte nicht weiter behandelt, aber die Symptome gelindert werden.
Auf der Palliativstation
Die leitende Oberärztin Evelyn Braune erinnert sich gut an Astrid L.: „Zunächst einmal brauchte die Patientin Zeit, um sich psychisch zu stabilisieren und Vertrauen aufzubauen. Die vorausgehenden medizinisch bedingten Ortswechsel und verunsichernden Situationen waren für Frau L. wie für viele Menschen mit geistigen Einschränkungen schwer zu verkraften. Die Patientin wurde zuvor in verschiedene Kliniken gebracht und in Berichten teilweise als aggressiv und ‚schwer führbar‘ beschrieben. Das sind manchmal aber einfach Zeichen für die Überforderung, die ein Mensch mit einer geistigen Behinderung so ausdrückt.“
Das Team der Palliativstation nahm sich von nun an viel Zeit für Frau L., die sich zunehmend einlassen konnte – und auch durchaus fordernd war. Hilfreich war, dass über die langjährige Betreuerin Margarete W. von Frau L. Biographisches und Vorlieben bekannt waren – beispielsweise die Liebe zum Malen. Evelyn Braune: „Dem Engagement von Frau W., die Frau L. über 20 Jahre begleitete und stets ihre Interessen vertrat, ist es unter anderem zu verdanken, dass die Patientin nun auch bei uns die Möglichkeit bekam, ihrer vertrauten Beschäftigung nachzugehen und wir einen persönlicheren Bezug aufbauen konnten.“
„Ich sterbe bald“
Wusste Frau L. um ihre Situation und ihre unheilbare Krankheit? Die Oberärztin bejaht. Sie präzisiert: „Es gab viele Gespräche über die Krankheit und vor allem die notwendigen Maßnahmen. Bis zu einem gewissen Grad ist das bei Frau L. angekommen. Sie hat sich auf ihre Weise damit auseinandergesetzt.“ Evelyn Braune erzählt, manchmal habe sie sich dazugesetzt, wenn Frau L. in ihrem Stuhl saß und nach innen gewandt wie ein Mantra den Satz wiederholte „Astrid muss sterben, Astrid muss sterben …“. Oder wenn Frau L., die immer gern Beschäftigung hatte, für die Pflegenden Handtücher faltete. Frau Braune erinnert sich: „Dann sprach sie wie zu sich selbst: ‚Ich sterbe bald.‘ Das hat mich bewegt.“ In klaren Phasen realisierte Frau L. ihre Krebserkrankung mit entsprechendem Leidensdruck. Auf der Palliativstation konnte sie auch in diesen Momenten intensiv und einfühlsam begleitet werden. Wie weit generell die Einsicht in Konsequenzen ging, bleibt eine Mutmaßung.
In Alltagssituationen wurde deutlich, dass es Grenzen im Verstehen gab. Frau Braune gibt ein Beispiel: „Frau L. wusste, dass sie eine Krankheit der Speiseröhre hat, die das Schlucken schwer bis unmöglich machte. Sie hatte mehrfach die unangenehmen Folgen erlebt, wenn dies nicht beachtet wurde. Und dennoch konnte sie meist dem Reiz nicht widerstehen, in einem unbemerkten Moment aus der Teeküche oder dem Bonbonglas eine Kleinigkeit zu stibitzen …“ Hier schmunzelt Frau Braune. Im gesamten Gespräch mit ihr scheint durch, welch tiefe, warme Erinnerung Frau L. hinterlassen hat.
Im Hospiz
Lebendig im Gedächtnis ist Astrid L. auch bei den Mitarbeiter:innen im stationären Hospiz in Gütersloh. Hier verbrachte sie das letzte Wegstück, nachdem ihr Zustand eine Rückkehr von der Palliativstation in ihr Zuhause nicht mehr zuließ. Mit großer Traurigkeit kam Frau L. hier an: „Ich bin doch auch nur ein Mensch, der leben will.“ Das ganze Team unterstützte sie nun, zumindest noch so viel Leben und Lebensqualität wie möglich in der letzten Phase zu erfahren.
„Ich höre noch immer Astrids Lachen“, erinnert sich die Pflegekraft Monika Elsner. „So rau und echt. Aber es konnte auch ganz schnell ins Weinen kippen – sie äußerte ihre wechselnden Gefühle auf jeden Fall unmittelbar und lautstark.“ Fröhlich war sie oft zum Beispiel dann, wenn Pfleger Cristian Lukas den Kontakt zu ihr ganz spielerisch gestaltete. Er erzählt: „Die Haltestange an der Wand erinnerte sie ans Turnen. Für ein paar Minuten war Astrid dann die Turnlehrerin und hatte Spaß daran, mir Übungen anzusagen, die ich an der Stange turnen sollte – und sich riesig gefreut, wenn es scheinbar anstrengend für mich war.“
„Ich will das nicht“
Für Cristian Lukas war Frau L. der erste pflegerische Kontakt zu einem Gast mit geistiger Behinderung. Was er dabei gelernt hat? „Man braucht ein gutes Gespür und ein offenes Herz, um zu verstehen, was ausgedrückt werden soll. Manchmal habe ich zum Beispiel ihre Traurigkeit ohne Worte gespürt. Dann habe ich versucht, mir viel Zeit für Astrid zu nehmen. Irgendwann sagte sie dann: ‚Astrid ist hier zum Sterben‘, so als wolle sie die Worte, den Gedanken ausprobieren.“ Seine Kollegin Monika Elsner ergänzt: „Ich bin nicht sicher, inwieweit Astrid die Endgültigkeit von Sterben begriffen hat. Manchmal hatte ich eher das Gefühl, Astrid erschien es wie eine Episode. Aber sie hat gespürt, dass etwas mit ihr passiert.“ Bei der Körperpflege habe man erst das Vertrauen von Frau L. gewinnen müssen. „Sie taxierte einen genau, spiegelte sofort, wenn man nicht ganz bei ihr war. Wir haben jeden Schritt erklärt, den wir machen. Sie war da sehr selbstbestimmt – wenn Astrid etwas nicht wollte, rief sie laut ‚Ich will das nicht‘. Ihre Direktheit war oft beeindruckend“, berichtet Monika Elsner.
„Astrid muss arbeiten“
Eine Herausforderung für das Pflegeteam war Frau L.s großer Wunsch nach Beschäftigung. „Astrid muss arbeiten“, forderte sie – denn so kannte sie ihre Tagesstruktur in den letzten Jahren. Erika van Stephaudt, auch Pflegekraft im Hospiz, erzählt von den Ideen, die das Team für Frau L. dazu entwickelt hat: „Astrid hat viele Stunden mit Eifer Medikamentendosen gespült oder Muttern auf Schrauben gedreht – Tätigkeiten, die ihr die Sicherheit ihres früheren Arbeitens in der Werkstatt vermittelten. Gerne hat sie auch die Spülmaschine ausgeräumt.“ Im Team ist viel dazu überlegt und gesprochen worden. Erika van Stephaudt: „Wir müssen selbstkritisch hinterfragen, ob und wie wir wirklich einem Menschen mit geistigen Einschränkungen seine gewohnten Strukturen geben können. Es war manchmal nicht leicht, parallel dazu auch der Betreuung der anderen Gäste gerecht zu werden.“
Gemalt hat Astrid L. auch im Hospiz weiterhin, doch irgendwann schwanden ihr selbst dafür die Kräfte. Ihr Sterben begann mit Unruhe und Angst, auch jetzt wollte sie auf keinen Fall allein sein. Gestorben ist Astrid L. dann ganz ruhig in ihrem Zimmer, begleitet vom Team und umrahmt von all ihren kunterbunten Bildern.